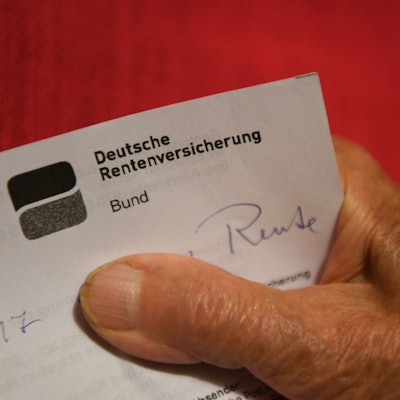Von Tempolimit über bezahlbares Wohnen bis hin zum Comeback der Atomkraft: Versprochen wird viel, aber was könnten wirklich passieren? Wir geben einen Überblick.
Bundestagswahl 2025Welche Wahlversprechen Realität werden könnten – und welche nicht

Die Grünen wollen ein generelles Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen.
Copyright: dpa
Man kennt das: Im Wahlkampf versprechen die Parteien das Blaue vom Himmel. Wenn es ans Regieren geht, kommt es dann aber doch anders. Gott sei Dank, sagen die einen. Schade drum, die anderen. Zur Bundestagswahl am Sonntag haben wir ein paar Leuchturm-Ideen und deren Chance auf Umsetzung in der nächsten Legislaturperiode unter die Lupe genommen. Ist Ihr Wunschtraum dabei?
Tempolimit
Schon vor der letzten Bundestagswahl hatte Grünen-Chef Robert Habeck angekündigt, im Fall einer Regierungsbeteiligung eine Tempobegrenzung auf Deutschlands Straßen einführen zu wollen. Daraus wurde bekanntlich nichts; mit den Liberalen in der Ampel-Koalition war der restriktive Eingriff in den Straßenverkehr nicht zu machen. Nun nimmt die Ökopartei einen neuen Anlauf. Ziel sind 130 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen. Zudem sollen Städte leichter flächendeckend Tempo 30 einführen dürfen.
Als Juniorpartner in einer schwarz-grünen Koalition würde es den Grünen jedoch schwerfallen, das durchzusetzen. Die Union würde ihrer Stammwählerschaft kaum zumuten wollen, diese Kröte zu schlucken. Die Junge Union hatte zuletzt sogar den Ausbau der Autobahnen gefordert, damit die Zahl der Geschwindigkeitsbegrenzungen reduziert werden könne. Getreu dem Motto: „Wir lassen uns nicht ausbremsen“.
Alles zum Thema Bundestagswahl
- Bundestagswahl Friedrich Merz lässt „Speed-Dating“ sausen – Habecks Bedingung für eine Regierung
- Irritationen innerhalb der Partei „Einfach nur noch peinlich“ – FDP-Fraktionschef imitiert Trump-Foto
- Forsa-Chef zur Bundestagswahl „Wir haben eine große Ratlosigkeit, was man wählen soll“
- Zahlreiche Erkrankungen In Kerpen fallen Wahlvorstände reihenweise aus
- Bundestagswahl Karl Lauterbach tritt hier an – was man im Wahlkreis 100 wissen muss
- Bundestagswahl im Kreis Euskirchen Fabio Centorbi von Volt sorgt sich ums Gesundheitssystem
- Juniorwahl Oberbergs Jugend probt den Urnengang – Kreisweit machen 25 Schulen mit
Milliardärssteuer
„Eine Mindestabgabe auf das Vermögen der reichsten Menschen der Welt würde dazu beitragen, die Finanzierung globaler Herausforderungen wie Klimaschutz und Armutsbekämpfung zu verbessern“, heißt es bei den Grünen. Superreiche höher zu besteuern als bisher, das fordern auch andere Parteien, die SPD beispielsweise oder Linke und BSW. Da ist dann wahlweise von Reichen- oder Vermögenssteuer die Rede. Letztere wird in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben, nachdem das Bundesverfassungsgericht zuvor ein bestehendes Gesetz für verfassungswidrig erklärt hatte.
Den Reichen nehmen, den Armen geben – das kommt nicht überall gut an. So lehnen CDU/CSU eine Vermögensteuer ebenso strikt als leistungsfeindlich ab wie FDP und AfD. Die Debatte, wie sie seit Jahren um die Besteuerung hoher Vermögen geführt wird, dürfte also noch eine Weile weitergehen, ohne dass sich substanziell etwas verändern wird.
Bezahlbares Wohnen
Für immer mehr Familien oder Senioren mit schmalen Renten wird Wohnraum unerschwinglich. Um das zu ändern, setzen die Sozialdemokraten wie schon in der abgelaufenen Legislatur auf den Dreiklang: Anreize zum Wohnungsbau, Verlängerung der Mietpreisbremse und mehr Sozialwohnungen. Doch schon unter SPD-Kanzler Olaf Scholz ist es nicht gelungen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu garantieren. Weder ist der Neubau ordentlich in die Gänge gekommen, noch sind ausreichend Wohnungen dort entstanden, wo sie sein müssten. Die Anzahl der Sozialwohnungen hat zuletzt sogar abgenommen. Und die Mietpreisbremse verfehlt zum großen Teil ihre Wirkung.
Wie die SPD ihre Ideen in einer möglichen Großen Koalition zum Erfolg führen will, bliebe also das Geheimnis der Genossen. Die Union ihrerseits will mit den Baustandards runter, mehr Wohngebiete ausweisen und bürokratische Hürden senken. Das klingt gut, doch die Erfahrung lehrt: Es wird kaum schnell gehen. Auch in der nächsten Legislatur ist also kaum eine Entspannung am Miet- und Wohnungsmarkt zu erwarten.
Vier-Tage-Woche
Ausdrücklich festgeschrieben im Programm hat es nur die Linke, und das für alle Branchen. Doch auch in den Reihen von Grünen und Sozialdemokraten liebäugeln viele mit einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich; zumindest bei den Gewerkschaften rennen sie damit offene Türen ein. Tatsächlich mag der Wunsch verständlich sein, bestimmte Jobs durch kürzere Arbeitszeiten attraktiver zu machen. Bis 2035 gehen allerdings rund sieben Millionen Arbeitskräfte verloren, weil sich die Babyboomer in den Ruhestand verabschieden. Die Arbeit aber, die sie hinterlassen, muss erledigt werden.
Sicher erfüllt sich mit einer Vier-Tage-Woche nicht in jeder Branche die damit verbundene Hoffnung sinkender Arbeitsbelastung bei gleichzeitig erhöhter Produktivität. Von den Kosten für die Unternehmen ganz zu schweigen. So sehen Unionspolitiker und Liberale das Thema mit ganz anderen Augen. Schwer vorstellbar also, dass die Idee, bei gleichem Geld weniger zu arbeiten, im nächsten Bundestag eine Mehrheit finden würde.
Böllerverbot
Jedes Jahr an Silvester sterben Menschen durch Böller oder werden schwer verletzt. Zudem treibt die Knallerei die Feinstaubbelastung in die Höhe. Dass die Grünen für ein ganzjähriges und bundesweites Feuerwerksverkaufsverbot sind, wundert da nicht. Zudem wollen sie mehr Spielräume für die Länder bei Verbots- und Erlaubniszonen. Unterstützung bekommen sie dafür inzwischen sogar von der Gewerkschaft der Polizei und Umweltverbänden; ihnen schwebt ein Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch vor. Deutschland auf dem Weg in die Verbotsrepublik?
Unionspolitiker und Liberale halten dagegen, die Böller-Verbotsdebatte gehe in die falsche Richtung. Der Verband der pyrotechnischen Industrie wiederum hält es für wichtiger, die Verbreitung von illegalem Feuerwerk einzudämmen, anstatt legales zu dämonisieren. Seit Jahren gibt es Anläufe für ein Böllerverbot; und angesichts von Ausschreitungen in den Großstädten wächst der Druck. Sollte es in der nächsten Legislatur tatsächlich dazu kommen, wäre das aber doch eine Überraschung – Feuerwerk zum Jahreswechsel ist schließlich auch ein Stück Kulturgut.
Mehr Tarifbindung
Nach dem Ausscheiden der Liberalen aus der Ampel hat das verbliebene rot-grüne Rumpfkabinett den Entwurf für ein Bundestariftreuegesetz beschlossen. Ziel ist es demnach, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen. Ganz im Sinne der Gewerkschaften soll mit dem Gesetz der Verdrängungswettbewerb über die Lohn- und Personalkosten eingeschränkt, und damit für faireren Wettbewerb, mehr Lohngerechtigkeit und mehr Tarifbindung gesorgt werden. Letztere geht nämlich seit Jahren zurück.
Im Bundestag hat das Tariftreuegesetz allerdings keine Mehrheit mehr bekommen. Und eine unionsgeführte Bundesregierung dürfte sich das Projekt kaum zu eigen machen – schließlich begreifen Arbeitgeberverbände das Vorhaben als unfreundlichen Akt der Politik. So wird es wohl – sehr zum Ärger des DGB – vorerst in den Schubladen der Ministerien verschwinden.
Mütterrente III
Die bayerischen Christsozialen versuchen erneut mit der Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente zu punkten. Die Gerechtigkeitsfrage der Gleichbehandlung aller Mütter in der Rente sei erst dann gelöst, wenn auch für vor 1992 geborene Kinder volle drei Erziehungsjahre in der Rente anerkannt würden, heißt es bei der CSU – trotz Bedenken der Schwesterpartei und zahlreicher Ökonomen. Im Wahlprogramm der Union findet sich die Forderung nicht; doch dass CSU-Chef Markus Söder zum Quälgeist werden kann, wissen sie bei der CDU zur Genüge.
Berechnungen der Rentenversicherung zufolge kostete eine Ausweitung der Mütterrente rund 4,45 Milliarden Euro im Jahr. Wenn das nicht zulasten der Beitragszahler gehen soll, müsste die Finanzierung in voller Höhe aus Steuermitteln erfolgen. Ob SPD und Grüne als mögliche Koalitionspartner der Union dieses Geld für ein bayerisches Prestigeprojekt locker machen würden, ist fraglich. Oder wäre vielleicht ein Kompensationsgeschäft á la Tempolimit gegen Mütterrente denkbar?
Renaissance der Atomkraft
Die AfD will alte Atomkraftwerke in Deutschland lieber heute als morgen wieder anlaufen lassen. Man werde, heißt es außerdem im Wahlprogramm, „neue, dringend benötigte Kernforschungszentren und Kernkraftwerke schaffen“. Sogar CSU-Chef Markus Söder hält eine Reaktivierung der letzten drei abgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland für möglich und möchte Deutschlands Rückkehr zur Kernkraft forcieren. Im Wahlprogramm der Union ist immerhin davon die Rede, die Angelegenheit zu prüfen.
Demgegenüber gibt es auch neben den Grünen zahlreiche Stimmen, die einem Revival nuklearer Energieerzeugung eine Absage erteilen – darunter die Chefs von Energiekonzernen. Die Kosten wären zu hoch, der Rückbau alter Meiler laufe auf Hochtouren, die Bauzeiten neuer Atomkraftwerke dauere lang und sei sehr teuer. Zudem lag der Anteil von Atomstrom am deutschen Energiemix zuletzt nur noch bei rund sechs Prozent. Und bei den Erneuerbaren ist Deutschland auf gutem Weg, jetzt muss es nur noch mit dem Netzausbau schneller gehen. Hier wäre eine jede Milliarde besser angelegt, als für die Rückkehr ins Atomzeitalter.
Abkehr vom Verbrenner-Aus
Um den CO2-Ausstoß zu verringern, sind ab 2035 in der EU Neuzulassungen von Pkw verboten, die mit herkömmlichem Benzin oder Diesel fahren. Die Union will dieses „Verbrenner-Aus“ am liebsten kippen. Auch den Liberalen ist die geltende Rechtslage ein Dorn im Auge. Das Argument: Ingenieure sollten entscheiden, welches die beste Antriebstechnologie ist, um den Straßenverkehr klimafreundlicher zu machen, nicht aber Politiker und Beamte.
Da die Chancen für eine schwarz-gelbe Regierung nicht gut stehen und sowohl SPD als auch Grüne, einen solchen Kurs in Brüssel nicht mitgehen würden, stehen die Chancen für das Aus des Verbrenner-Aus schlecht. Allenfalls über mehr Flexibilität könne man reden, warnte der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, im Interview mit unserer Redaktion. Zudem haben sich die deutschen Autobauer inzwischen auf die E-Auto-Zukunft eingestellt; und wollen die Hersteller im internationalen Wettbewerb vor allem mit China bestehen, sollten sie den eingeschlagenen Weg konsequent weiter verfolgen, sagen Branchenbeobachter. Das Argument dürfte früher oder später auch bei Unionspolitikern ankommen.