Kehlmann erzählt in seinem Roman das schillernde Leben des großen Regisseurs Georg Wilhelm Pabst, der in Amerika scheiterte und dann den Verlockungen Goebbels erlag.
Neuer Roman in der KritikDaniel Kehlmann liefert mit „Lichtspiel“ ein herausragendes Werk

Daniel Kehlmann
Copyright: dpa
Über das Kino weiß er alles, doch tatsächlich fühlt sich der virtuose Regisseur oft im falschen Film: immer wieder zur Unzeit dort, wo er besser nicht wäre. Diese Tragik zieht sich durch Daniel Kehlmanns herausragenden Roman „Lichtspiel“ über Georg Wilhelm Pabst (1885 - 1967). Vollplastisch steht er schon in der ersten Episode vor uns, 1933 in Hollywood.
Zuvor hatte der Österreicher Greta Garbo in „Die freudlose Gasse“ geschickt und die unverschämt sinnliche Louise Brooks „Die Büchse der Pandora“ öffnen lassen. Doch die Warner-Bros.-Bosse rühmen ihn peinlicherweise für Fritz Langs „Metropolis“...
Mit bohrender Präzision inszeniert Kehlmann das Mismatch zwischen dem Emigranten und der Traumfabrik: G.W. Pabst schwitzt, kann kaum Englisch, merkt auch nicht, dass der Zuckerguss falscher Komplimente nur kalten Business-Stahl kaschiert. Von seiner Filmidee einer grimmigen Kriegsparabel will man nichts wissen und zwingt ihm den absehbaren Flop „A Modern Hero“ auf.
Verzweifelt besucht er seine Stummfilm-Diven: Garbo, die Eisprinzessin, und Brooks, die lebende Flamme. Ihr Mitwirken würde ihm eine zweite Chance verschaffen. Doch die Schwedin weiß: „Kein Emigrant überstand einen Misserfolg.“ Und Louise hat zwar Ruhm und Geld verprasst, bleibt aber lieber Star ihres wilden Lebens.
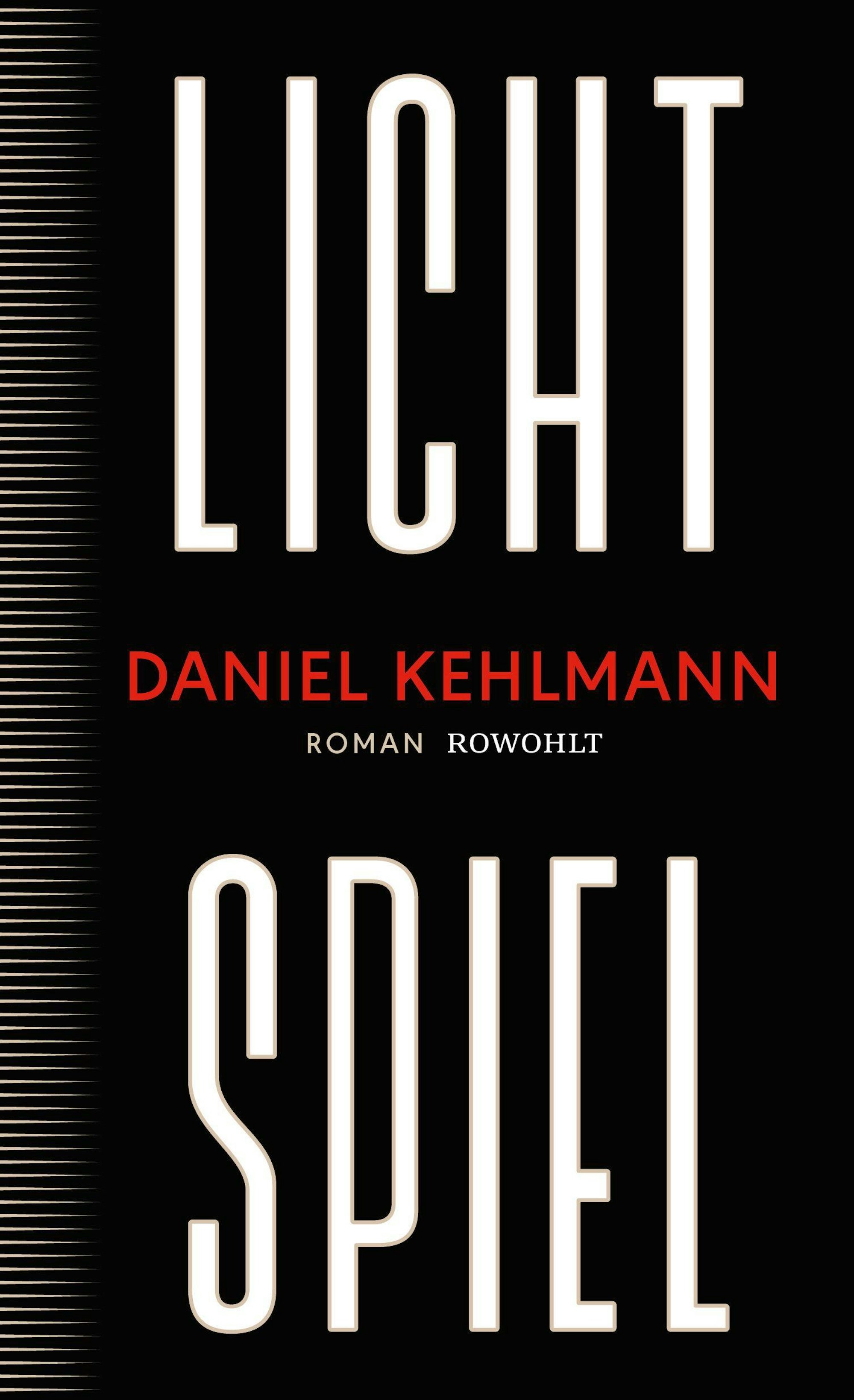
Das Cover des Romas 'Lichtspiel' von Autor Daniel Kehlmann
Copyright: dpa
Schon in diesen leuchtstarken Szenen bewährt sich die Methode des Autors („Ruhm“, „Tyll“). Statt sich ans Geländer der Pabst-Biografie zu klammern, setzt er sein Porträt filmisch aus Rückblenden, Perspektivwechseln sowie realen und fiktiven Figuren zusammen. Diese fliegende Erzählkamera liefert stets gestochen scharfe Bilder: am Pool von Fred Zinnemann, im Kopf der Garbo oder im Büro jenes dämonischen Filmministers, der Goebbels hieß, hier aber namenlos bleibt.
Da gibt es Pabsts Albtraum-Erinnerungen an seine Ko-Regie für Arnold Fancks Bergdrama „Die weiße Hölle vom Piz Palü“, als „ihm der Wind ins Gesicht peitschte und Fräulein Riefenstahl sich bemühte, eine Schauspielerin zu sein“. Aber eben auch die notdürftig in Alkohol ertränkte Tristesse seiner Ehefrau Trude und die Ängste des kleinen Sohns Jakob. Alles ist so einfühlungsintensiv herangezoomt, als ob der 48-jährige Schriftsteller allzeit präsenter Augenzeuge gewesen wäre.
Der kleine Nazi von nebenan
Nach dem USA-Debakel will Pabst in Frankreich drehen, reist aber noch rasch zurück nach Österreich. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und versperrt alle Fluchtwege. Das braune Grauen spiegelt Kehlmann vor allem an der Alltagsfront. Plötzlich in der Hauptrolle: der kleine Nazi von nebenan wie Pabsts Hausmeister Jerzabek – gestern noch Duckmäuser, jetzt Diktator im Schloss. Oder jene Grenzer, die ausreisende Juden zynisch zurück ins Verderben winken.
G.W. Pabst wird derweil sogar mit KZ-Drohung zu Werken erpresst, „die guten, tiefen, metaphysischen Menschen ans deutsche Herz gehen“. Wobei er in „Paracelsus“ immerhin einen Totentanz hineinschmuggelt. Schlimmer noch: Er muss der „Sport-, Marsch und Fackelregisseurin“ Leni Riefenstahl bei „Tiefland“ assistieren, jenem Film, der seine Statisterie mit Sinti und Roma aus Zwangslagern auffüllt.
Wird der Künstler hier bei allem Unbehagen nicht doch zum Kollaborateur des Systems? Kehlmann maßt sich kein Urteil an, macht aber klar, dass der Regisseur selbst um den Preis seines Eheglücks nie vom Kino lässt. Doch der Schriftsteller gönnt seinem Helden einen kreativen Aufstand: Ausgerechnet einen Roman des Regime-Günstlings Alfred Karrasch verfremdet er subversiv. Getreu seiner Überzeugung: „Drehen kann fast jeder. Beim Schneiden macht man erst den Film.“
Nur fällt der Schnitt zum „Fall Molander“ ausgerechnet in die Tumulte des Prager Aufstands. Eine von Kehlmann furios imaginierte Chaos-Szenerie, in der Pabst und sein (fiktiver) Assistent Franz Wilzek das Unmögliche in letzter Sekunde schaffen.
Warum der Film verschollen ist, sei nicht verraten. Die Auflösung ist nämlich ein weiterer Clou von „Lichtspiel“, dem der Oscar als bester Roman über das Kino in katastrophalen Zeiten gebührt.
Daniel Kehlmann: Lichtspiel. Roman, Rowohlt, 471 S., 26 Euro. Kölner Lesung: 21.10., 20 Uhr, WDR, Klaus-von-Bismarck-Saal.

