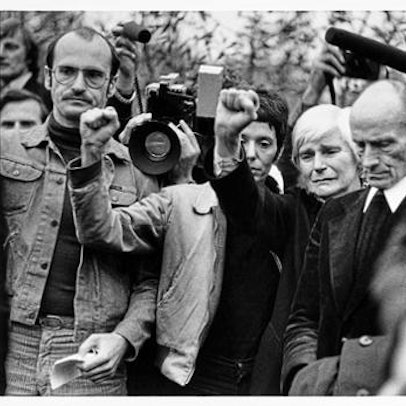„Ganz Schön Heftig“Kölner Wallraf-Museum zeigt die „Karlsruher Passion“
Köln – Dieses Bild droht vor Brutalität zu bersten: Der ohnehin von der Geißelung malträtierte Körper Jesu wird mit brachialer Gewalt ans Kreuz genagelt, wobei einer der tumben Schergen die Bohrlöcher falsch platziert hat. So muss der Leib zusätzlich schmerzhaft gedehnt werden. Diese „Kreuzannagelung Christi“ ist der blutige Schlussakkord jener „Karlsruher Passion“, deren sieben meisterhafte bemalte Holztafeln nun in einem eigenen Raum der Mittelalterabteilung des Wallraf ausgestellt werden.

„Dornenkrönung Christi“ aus der „Karlsruher Passion“.
Copyright: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Kurator Roland Krischel rühmt die exquisite Qualität der Werke, ihre affektgeladene Dichte, die den Betrachter zum Mitleiden zwingt. Dies beginnt schon, wenn der Gottessohn beim Gebet am Ölberg vergebens um Schonung bittet und angesichts des künftigen Martyriums Blut und Wasser schwitzt.
Den Zyklus wiedervereinigt
Die „Karlsruher Passion“ trägt ihren Namen in zweierlei Hinsicht zu Unrecht: Zum einen ist ihr Urheber offenbar der Straßburger Maler Hans Hirtz, der den Zyklus um 1450 schuf. Zum anderen gehört die zweite Tafel („Gefangennahme Christi“), das Glanzstück der Leidensgeschichte, seit 1859 als Schenkung aus dem Nachlass des Kölner Schuhmachers Heinrich Schläger dem Wallraf.
Die übrigen Gemälde trug allerdings über 150 Jahre die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zusammen, als letztes erwarb man 1999 die „Geißelung“ für einen zweistelligen Millionenbetrag. Da die Kunsthalle sanierungsbedingt länger geschlossen ist, ermöglichte sie die einjährige Wiedervereinigung aller erhaltenen Tafeln am Rhein.
Krischel attestiert dem Schöpfer einen „horror vacui“, die Angst vor leerem Bildraum. Tatsächlich scheinen das dicht gedrängte, kühn gestapelte Personal und die Fülle sprechender Details (samt antijüdischer Karikaturen) fast den Rahmen zu sprengen. Hirtz setzte auf erzählerische Leitmotive und Finessen, spiegelte etwa Kirchenfensterer in Rüstungen .Da er die Bilder paarweise komponierte, dürfte mindestens ein Werk verschollen sein. Es spricht viel dafür, dass die Tafeln ursprünglich Türen vor den Nischen der Straßburger Kirche St. Thomas schmückten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Und dafür, dass Hirtz seinen Zeitgenossen Stefan Lochner besucht und in Köln die Passionsfolge eines anonymen Meisters gesehen hat. Diese ist ebenfalls ausgestellt und verrät spannende Parallelen zu den leuchtstarken, sengend intensiven Gemälden des Straßburgers. Die muss man gesehen haben.
8.4. 2022 bis 16.4.2023, Di bis So 10–18 Uhr, 1. und 3. Do jeweils bis 22 Uhr. Obenmarspforten. Begleitheft, 20 S., 2 Euro.