Angst, Hunger, aber auch Widerstand: So erlebten verschiedene Zeitzeugen das Ende des Zweiten Weltkriegs im Rhein-Erft-Kreis.
Serie zum KriegsendeAls Kinder im Erft-Kreis aus Angst unter fremde Röcke flüchteten

Theodor Potes, im Bild der kleine Junge links vorne, hatte unter den Röcken einer Bäuerin Schutz vor den Bomben gesucht.
Copyright: Familie Potes privat
80 Jahre nach Kriegsende sind die meisten Zeitzeugen, also Menschen, die die Ereignisse mit Bewusstsein miterlebt haben, nicht mehr am Leben. Um so berührender war es, als Albert Esser, 90 Jahre alt, Bürger des heutigen Erftstädter Ortsteils Blessem, in einem Vortrag im März über seine Erlebnisse berichtete.
Erftstadt: Als verblendete Deutsche die Infrastruktur zerstörten
Esser erinnert sich daran, dass es zwischen Köttingen und Liblar zwei FLAK-Stationen gab (FLAK = Flugabwehrkanonen), die von den Amerikanern bombardiert wurden. Die FLAK wurde verfehlt, allerdings gingen Bomben quer durch Blessem, wobei es keinen Toten gab. Dennoch versetzten die alliierten Tiefflieger die Bevölkerung in Angst und Schrecken, da sie nicht durch die Flugabwehr erreicht werden konnten.
Auch in Blessem versuchten verblendete deutsche Resttruppen, Infrastruktur zu zerstören: Drei Brücken wurden in die Luft gejagt, berichtet Esser, bevor die Amerikaner Blessem erreichten. Die Blessemer Bürger wurden in die Burg geschickt, eine Begründung wurde ihnen nicht gegeben. Bei einem Artillerieangriff wurde das Burggelände getroffen, es gab keine Toten, nur eine Schafherde erwischte es. Kurze Zeit später teilte Pastor Jägers mit: „Ihr könnt wieder nach Hause gehen!“
Zwangsarbeiter aßen heimlich am Tisch mit
Auch in den heutigen Erftstädter Ortsteilen gab es ausländische Zwangsarbeiter. Esser: „Bei den Landwirten ging es ihnen besser als in den Fabriken!“ Offiziell durften sie nicht mit den Deutschen an einem Tisch die Mahlzeiten einnehmen. Allerdings hielten sich Blessemer Landwirte nicht an diese Anweisung. Ein ortsbekannter Nazi namens Rothkamp beschwerte sich bei ihnen, die Blessemer ignorierten das.
Der Vorsitzende des Heimatvereins Quadrath-Ichendorf, Markus Potes, hat in der Schriftenreihe „Geschichte und Geschichten um Quadrath-Ichendorf“ eine an Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel“ erinnernde Geschichte seines Vaters Theodor Potes wiedergegeben: „Es war an einem Tag im Oktober des Kriegsjahres 1944. Ich, damals 13-jährig, half bei der Kartoffelernte auf den Äckern von Christian und Maria Feuer. Während wir die Kartoffel auflasen, rasten plötzlich aus der Richtung der ehemaligen Grube Fortuna/Schlosspark Schlenderhan kommend zwei feindliche Flugzeuge über uns her und beschossen uns.
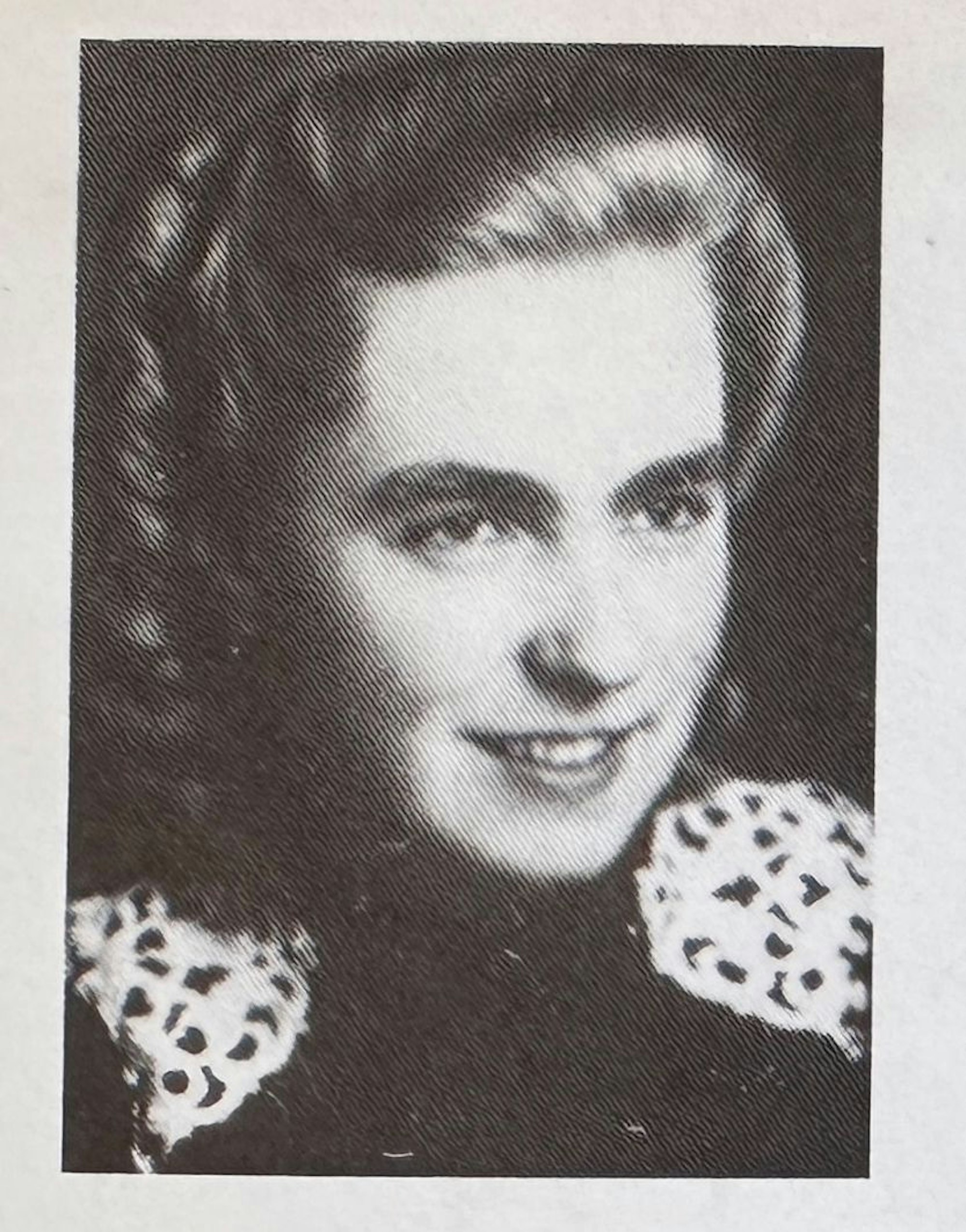
Maria Schlosser berichtet über ihre Erlebnisse in Zieverich und klagt darüber, die sie sich von den Nazis verraten fühlte.
Copyright: Stadtarchiv Kerpen
Schon bei den ersten Motorgeräuschen liefen wir – Frau Köhler und ich – von der Angst getrieben, so schnell uns die Beine trugen, zu dem einzigen Schutzobjekt, was sich in der Nähe befand – einem zweirädrigen Schlagkarren – und warfen uns zwischen die Räder unter die Ladefläche.
Als die Motorgeräusche der beiden Flugzeuge verstummten und die Angst von mir wich, fand ich mich zwischen den Beinen unter dem langen Rock der Frau Köhler wieder. Dort hatte die Angst mich unbewusst hingetrieben. Noch viele Jahre danach hörte ich von Frau Köhler, wenn sich unsere Wege kreuzten: „Jong, du bess mer allt ens unger dem Rock jewässe!“
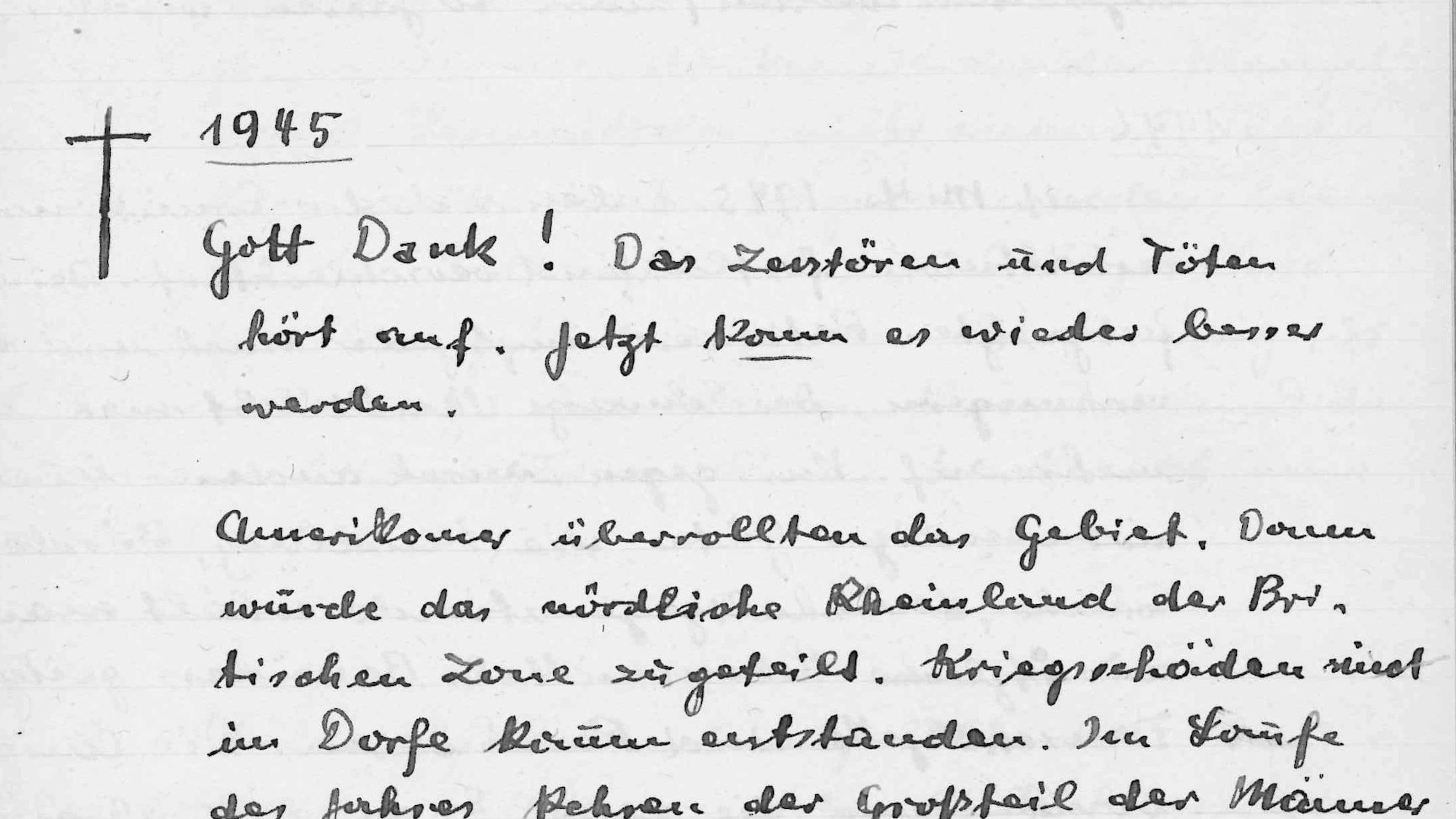
Die Schulchroniken von Brüggen und Horrem geben einen Einblick ins Leben am Kriegsende und wie die Schulen betroffen waren.
Copyright: Stadtarchiv Kerpen
Was die Tage am Ende des Krieges für den Alltag der Menschen bedeuteten, zeigt eindrücklich die Schulchronik der Schule zu Sinthern, nachzulesen auf der Website der Stadt Pulheim: „März, 1: Einzug der amerikanischen Truppen, Belegung der Wohnräume im Schulhause für rund acht Tage. 22 Stunden vor der Besetzung brachte fast die ganze Einwohnerschaft von Sinthern im Bunker zu. Während dieser Zeit lag das Dorf unter stetem Artilleriebeschuss. Treffer erhielten unter anderem auch Kirche und Schule. Da ein amerikanischer Offizier auf der Hubertusstraße erschossen aufgefunden wurde, ward die gesamte Bevölkerung unter militärischer Bewachung auf dem Berghof untergebracht.
Rund 100 Menschen mussten so in den Wohnräumen, Ställen, Scheunen und Schuppen 8 Tage verbringen. Eine Klärung des vorgenannten Falles war leider nicht möglich. Der Ortspfarrer brauchte nur eine Nacht auf dem Berghof zu verbringen. Jedoch stattete er jeden Abend seiner Gemeinde einen längeren Besuch ab. Die Bauern durften zur Versorgung ihres Viehes mehrmals am Tage für eine bestimmte Zeit ihre Wohnungen aufsuchen. Ab 3. Tag erfolgte Gemeinschaftsverpflegung. Zu diesem Zwecke waren Notschlachtungen gestattet.“

Der 90-jährige Lokalhistoriker Albert Esser berichtete über seine Erlebnisse in Blessem am Kriegsende.
Copyright: Bernd Woidtke
In der Chronik der Türnicher Schule, einzusehen im Archiv der Stadt Kerpen, ist zu lesen: „Alles atmete auf, als am 2. März 1945 die Amerikaner einrückten, und Türnich besetzt wurde. Im Schulgebäude wurden ca. 120 amerikanische Soldaten (Farbige) untergebracht. Diese, und die vorher in der Schule untergebrachten deutschen Einheiten, haben die Inneneinrichtung der Schule, die Lehrer- und Schülerbüchereien, Lehr- und Lernmittel, Kartenbestände und dergleichen fast ganz vernichtet oder unbrauchbar gemacht. Von den in der Schule vorhandenen Schränken wurden Fensterabdichtungen angefertigt.“
Es folgte eine Auflistung der verschwundenen oder beschädigten Gegenstände. Als Fazit heißt es dann: „Es hätte manches noch gerettet werden können, wenn zu dieser Zeit der Schulleiter anwesend gewesen wäre. Er war Soldat. Eine Lehrerin vertrat ihn. In den kritischen Tagen mußte sie die Wohnung räumen und durfte das Schulgebäude nicht mehr betreten. So fand ich denn die Volksschule Türnich bei meiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft in einem beklagenswerten Zustand vor.“
Rhein-Erft-Kreis: Zahlreiche Ortschaften wurden zerstört
Aus der Chronik erfährt man auch, dass am 1. August 1945 der Unterricht wieder begonnen hat. Die Bergheimerin Maria Schlosser, geb. Frenger, erinnerte sich: „Unser kleines Zieverich wurde furchtbar zerstört. An der Kreuzung (Aachener Straße, B 55 alt Richtung Elsdorf) waren alle Häuser dem Erdboden gleich, denn hier rollte ja der Nachschub Richtung Jülich an die Front. Die Chaussee nach Bergheim war nur noch ein Bombentrichter. Die Bäume standen da wie abgeknickte Streichhölzer. In einer Radiosendung hörte ich damals Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goebbels.
Er sagte wörtlich: ‚Auch die Räumung des linksrheinischen Gebietes konnte noch rechtzeitig erfolgen, nur der rote Mob ist zurückgeblieben.‘ Das war wie ein Faustschlag ins Gesicht, weil wir trotz des Grauens bis zuletzt durchgehalten hatten. Ein Räumungsbefehl an uns war nie ergangen. So also hatte man uns verraten und verkauft.“ (Quelle: Stadtarchiv Kerpen)

Der US-Soldat hat in Bedburg mit seinen Kollegen die Bekanntschaft mit deutschem Schwarzbrot gemacht.
Copyright: The Newtown Bee
Natürlich gibt es nicht nur deutsche Zeitzeugen. In seinem Buch „1945 – Der Krieg im Kreis Bergheim/Erft“ zitiert der Autor Wilhelm Weiss einen US-Soldaten, der sich an seine Zeit in Bedburg erinnert: „Nach der Einnahme von Bedburg wurde die Zivilbevölkerung zusammengetrieben. Wir durchsuchten die Häuser und mein Kamerad Fred Kampmier begann damit, trotz eindringlicher Warnung unserer Vorgesetzten vor vergiftetem deutschen Essen, in jedem Haus ein kleines Frühstück zu sich zu nehmen.
Daraufhin ignorierten wir alle Warnungen und aßen alles, was wir in die Hände bekamen. Knochenhartes deutsches Schwarzbrot, das wie Sägemehl schmeckte, obwohl unser Kamerad Royce ein Anhänger von Weißbrot war. Alles wurde gegessen. Als Leroy Wagner in ein Haus mit gedecktem Tisch kam, setzten sich alle an den Tisch und fraßen sich voll. Unsere Soldaten durchsuchten alle Schränke nach Essbarem – egal was – außer Sauerkraut. Die Lebensmittel, die wir fanden, waren ein Hochgenuss gegenüber unseren eintönigen K und C Rationen. Deshalb war kein Huhn, Kaninchen, Schwein, ja sogar eine Kuh nicht sicher vor uns.
US-Soldaten zerstörten Mobiliar und aßen alles, was sie fanden
Wenn wir etwas sahen, was wir gebrauchen konnten, nahmen wir es ohne zu zögern mit. Gewissensbisse hatten wir dabei nicht. Die Möbel der Häuser dienten uns als Brennholz und wenn wir in einem Haus einen Bilderrahmen mit dem Bild eines Wehrmachtsoldaten fanden, wurde dieses aus lauter Wut zerstört. In normalen Zeiten wären wir Verbrecher gewesen, aber es war Krieg. Jeder Wunsch konnte erfüllt werden. Ob es nun Schmuck, Besteck, Kameras oder die begehrten Luger oder Walther Pistolen waren, es gab alles. Die Offiziere transportierten ihre erbeuteten Schätze mit dem Lastwagen, aber der einfache Soldat musste alles selber tragen. Da aber Gewicht der Feind eines Infanteristen ist, hatten wir dabei erheblich Probleme.“
„Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“ (Ezechiel 18,2) – so steht es in der hebräischen Bibel. Was bedeutet dieser Satz? Das Leiden der Kriegsgeneration hat sich nicht nur in diesen Menschen festgesetzt, es vererbt sich weiter in den nachfolgenden Generationen. Die Kinder der Kriegsgeneration wagten es oft nicht ihre Eltern zu fragen, aus Angst, dass diese ihre Verstrickung in die nationalsozialistischen Gräueltaten offenbaren könnten. Die Enkel wiederum fragten ihre Eltern: Warum habt ihr die Großeltern nicht gefragt? So blieben die Kriegstraumata jahrzehntelang unausgesprochen.
Margarete und Alexander Mitscherlich haben in ihrem psychoanalytisch basierten Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“, erschienen 1967, aufgezeigt, wie die Verdrängung der Beteiligung an Kriegsverbrechen zu psychosomatischen Störungen führte. Die junge Forschungsrichtung der Epigenetik diskutiert die Weitergabe auch von psychosomatischen Störungen an nachfolgende Generationen. Der Zweite Weltkrieg endete zwar mit der Kapitulation am 8. Mai 1945, seine Folgen sind aber bis heute virulent.

