Teils gravierende Probleme strapazieren das Nervenkostüm von Richtern – Gefährden sie auch die Sicherheit?
Wann kommt die E-Akte?Wie es um die Digitalisierung in der Justiz bestellt ist
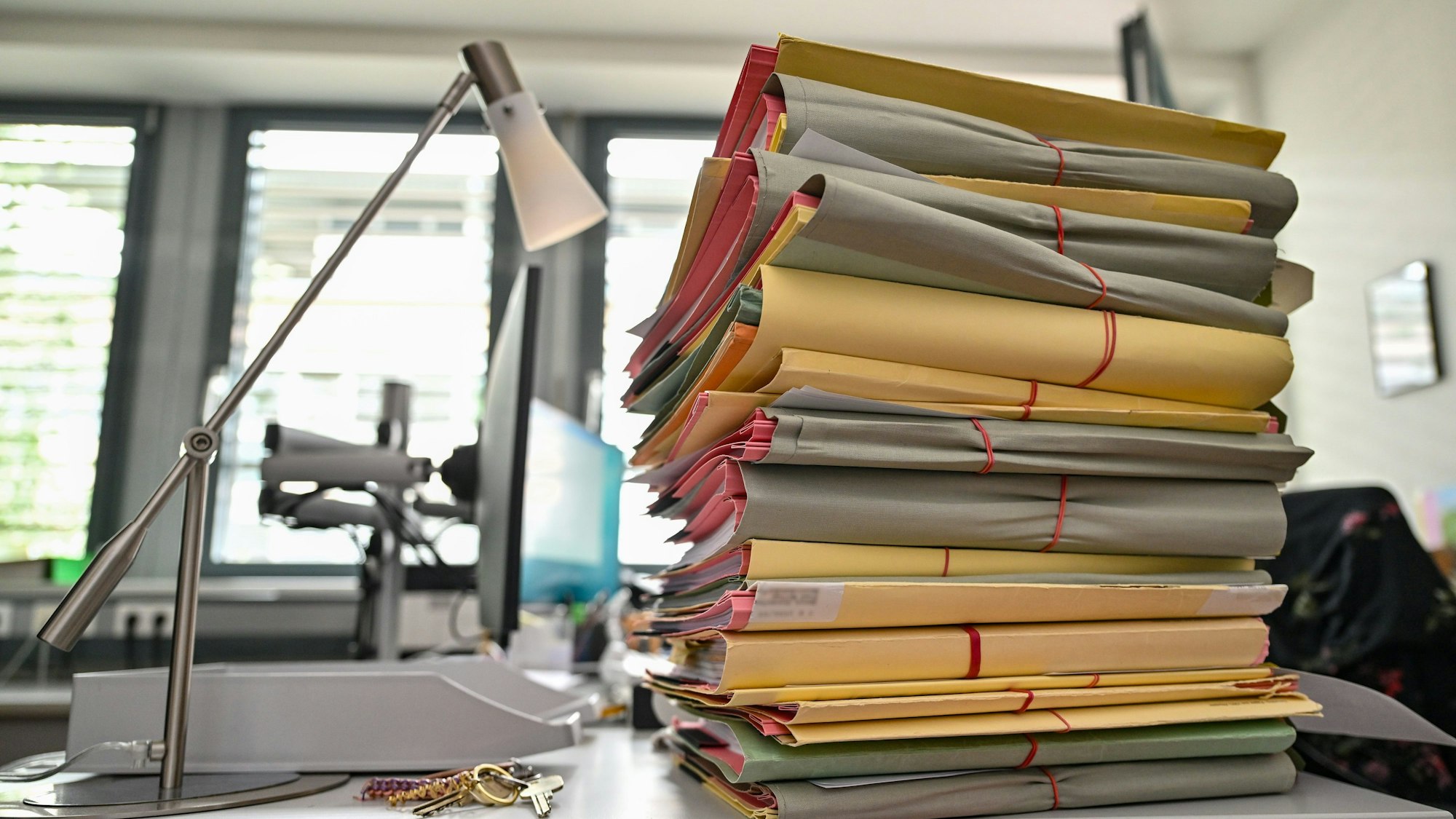
In vielen deutschen Gerichten wird der Arbeitsalltag immer noch von Aktenbergen aus Papier bestimmt.
Copyright: dpa
Der Angeklagte, der sein Gesicht vor den Kameras hinter einem Aktendeckel versteckt – jahrzehntelang waren solche Szenen fester Bestandteil großer Strafprozesse in Deutschland. Doch bald könnte die physische Akte ganz aus deutschen Gerichtssälen verschwinden. Denn die Justiz wird auf die elektronische Akte umgestellt und Arbeitsabläufe weitgehend digitalisiert.
Bis zum 1. Januar 2026 muss der Prozess abgeschlossen sein. So will es das Gesetz. Vielerorts sind Bereiche wie Verwaltungs- oder Familiengerichte bereits umgestellt, als Letztes folgt häufig die Strafjustiz. Reibungslos läuft das Ganze jedoch nicht. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten Juristen von teils haarsträubenden Problemen, die möglicherweise auch sicherheitsrelevant sein können.
Justiz in NRW: Abstürze und Technikprobleme
Vor allem die Leistungsfähigkeit der Systeme bereitet Kopfzerbrechen: Ein Amtsrichter aus Nordrhein-Westfalen berichtet von Komplettabstürzen der Technik. Über Stunden seien die digitalen Akten nicht mehr zu öffnen gewesen. Auch beim Versenden von E-Mails hake es. Ein Problem, das Juristen aus anderen Bundesländern gut kennen. Ein Verwaltungsrichter aus Niedersachsen spricht vom „Donut des Todes“, der sich drehe und drehe.
Einblicke ins„Amtsgericht Schilda“Wie sehr Juristen von der Technik ausgebremst werden, kann jeder Interessierte auf Instagram verfolgen: Unter dem Account des fiktiven „Amtsgericht Schilda“ gibt ein Richter des Amtsgerichts Itzehoe Einblicke in seinen teildigitalen Arbeitsalltag. Schnell entsteht dabei der Eindruck, die Digitalisierung der Justiz sei zumindest in Schleswig-Holstein eine Totalkatastrophe.
Das Ministerium in Kiel teilt mit, es handele sich bei den Beiträgen aus Itzehoe um „eine sehr individuelle und zugespitzte, jedenfalls nicht repräsentative Sicht“. Überwiegend sei die Zustimmung hoch, auch wenn es „Gewöhnungsschwierigkeiten“ gebe: „Wer sein bisheriges Berufsleben lang gewohnt ist, mit Papier zu arbeiten, benötigt naturgemäß Zeit, um sich vollständig umzustellen.“
E-Akte: Richter in Sorge
Viele Richter sind in Sorge, ob die Systeme der Komplettumstellung standhalten werden. Denn mit der Strafjustiz kommt ein großer Bereich hinzu, in dem auch zeitkritische Entscheidungen gefällt werden müssen: Haftbefehle oder Durchsuchungsbeschlüsse beispielsweise. „Da ist manchmal hoher Zeitdruck, da kann man es sich nicht leisten, auf einen Ladebalken zu starren“, sagt ein Amtsrichter. Notfalls werde doch wieder ausgedruckt oder das Faxgerät aktiviert.
Das Justizministerium in Niedersachsen teilt mit, man stocke die Serverkapazitäten weiter auf. Dadurch sollen Ladehemmungen oder Totalausfälle in der Zukunft verhindert werden. Ähnlich agieren derzeit fast alle Länder. In manchen Fällen aber kommt das wohl zu spät. Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger räumte kürzlich ein, dass ihr Land nicht an allen Gerichten rechtzeitig bis 2026 die Umstellung schaffe und die Papierakte länger erhalten bleibe.
Dabei sind nicht nur einzelne Gerichte mit der Umstellung überfordert. Alle Richter, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, verweisen auf die aus ihrer Sicht größte Schwachstelle: die fehlende Einheitlichkeit. So werden in den Bundesländern unterschiedliche Programme eingeführt. Was also passiert, wenn künftig eine E-Akte aus Bayern nach NRW geschickt wird, scheint derzeit noch unklar. „Im Zweifelsfall ausdrucken“, sagt ein Strafrichter. In anderen Fällen sollen schon CDs über Ländergrenzen hinweg verschickt worden sein.
Schnittstelle zur Polizei fehlt
Doch auch innerhalb der einzelnen Bundesländer gibt es Bruchstellen. Zwar hat die Politik die Umstellung der Justiz auf die E-Akte beschlossen. Doch gerade im Bereich des Strafrechts sind die Gerichte auf die Arbeit anderer Behörden angewiesen: Die Polizei ermittelt zu Straftaten, die Staatsanwaltschaften klagen sie an. Bislang sind aber deren Computersysteme noch nicht kompatibel, was einen erheblichen Mehraufwand bei den Gerichten auslösen könnte.
Zwar geben sich die zuständigen Landesministerien zuversichtlich, dass Polizei und Justiz fristgerecht ihre unterschiedlichen Systeme so aufstellen können, dass der Übergang zur E-Akte reibungslos funktioniert. Doch Richter und Polizisten, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, haben so ihre Zweifel, ob diese Lösung noch rechtzeitig kommt. In einem Punkt sind sich alle einig: Wenn die Systeme erst einmal alle reibungslos laufen, dann wird das die Arbeit der Justiz besser machen. Wann es wirklich so weit ist, bleibt aber abzuwarten.