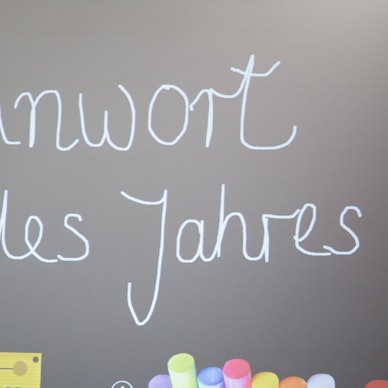Sechs Stunden Wüten und Rasen„Aus dem bürgerlichen Heldenleben“ im Schauspiel Köln

Lilith Stangenberg und Sophia Burtscher
Copyright: Thomas Aurin
- „Aus dem Bürgerlichen Heldenleben“ feierte am 17. Januar Premiere im Schauspiel Köln.
- Frank Castorf Inszeniert den Komödienzyklus von Carl Sternheim, indem er ihn mit langen Passagen aus dessen Roman „Europa“ verbindet.
- Das Publikum erwartet sperrige Sprache, Themen vom Kaiserreich bis in die Neuzeit und ein Krokodil.
Köln – Irgendwann im Verlauf des Stücks kommt ein riesiges Krokodil von rechts, kriecht gemächlich über die gesamte Länge der Bühne, um sie durch die Tür auf der linken Seite wieder zu verlassen. Die Feiergesellschaft tanzt um das Tier herum, springt drüber weg, tritt auch mal dagegen, als es schon wieder lästig und langweilig geworden ist. Ein wunderlicher Moment, ein Bruch in Frank Castorfs Inszenierung „Aus dem bürgerlichen Heldenleben“ nach Carl Sternheim, der auch deshalb so surreal wirkt, weil für kurze Zeit ausnahmsweise mal nicht gesprochen wird.
Das Publikum nahm ihn bei der Premiere des Stücks im Depot 1 des Schauspiels Köln dankbar an. Denn vorher und nachher prasseln auf den Zuschauer derart gewaltige Massen unbekannten Textes ein, dass Schauspieler Bruno Cathomas seine Mitspieler schon im ersten Drittel der knapp sechsstündigen Aufführung mahnt: „Das Publikum versteht im Moment kein Wort.“ Aber es hilft ja nichts, wir müssen da durch, Akteure und Zuschauer gleichermaßen.
Familienchronik zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik
Castorf hat für seine zweite Kölner Inszenierung innerhalb von weniger als eineinhalb Jahren Auszüge aus Sternheims vierteiligem Komödienzyklus „Aus dem bürgerlichen Heldenleben“, eine satirische, bitterböse und politisch hellsichtige Familienchronik aus der Zeit zwischen Kaiserreich und früher Weimarer Republik, mit langen Passagen aus seinem Roman „Europa“ verbunden. Oder besser: krude zusammenmontiert und notdürftig verschraubt oder verzwirbelt.
Was zusammen mit der expressionistisch-sperrigen Sprache Carl Sternheims, der vor allem im fast vergessenen Roman gern mal die übliche Satzstellung zertrümmert und die Teile dann recht willkürlich zusammenfügt, herkömmliches „Verstehen“ unmöglich macht. Das Stück droht an manchen Stellen auseinanderzufallen, dafür öffnen sich Assoziationsräume.
Glanzleistungen der Schauspieler
Sternheim zeigt – durchaus fasziniert von ihrer Dynamik – die gärende, aufgewühlte Welt am Ende des langen 19. Jahrhunderts. Castorf lässt die handelnden Personen wüten und rasen, hysterisch schreien, stottern und stammeln, geifern, heucheln, morden und verzweifelt lachen bei ihren Versuchen, die massiven gesellschaftlichen Veränderungen durch technologischen Fortschritt, Industrialisierung und Aufstieg des Kapitalismus auf je unterschiedliche Weise zu verarbeiten.
Das könnte Sie auch interessieren:
Den gierigen Emporkömmling Christian etwa, von Peter Miklusz wunderbar schmierig-entschlossen gespielt, der seine Eltern und seine Geliebte für die geleisteten Dienste auszahlt, um sie loszuwerden. Beim übriggebliebenen wilhelminischen Offizier Traugott kann Cathomas seinen Hang zu Klamauk und Slapstick auf hinreißende Art ausleben. Als betörende Europa mit ihrer Hingabe an die Möglichkeiten der neuen Zeit, an die Ideen von Marx und Lenin, an Poesie, sexuelle Befreiung und eine umfassende Gleichberechtigung der Geschlechter verausgabt sich Lilith Stangenberg bis zum Äußersten. Eine Glanzleistung.
Bühnenbild und Musik eher konventionell
Weniger eindrucksvoll und prägnant sind da schon die ominösen Slow-Jazz-Klänge à la „Twin Peaks“ und der leicht psychotische Gitarren-Rock. Beinahe konventionell sogar das Bühnenbild von Aleksandar Denic: ein Fin-de-Siècle-Ballsaal in vor sich hin schimmelnder Grandezza, der sich über die ganze Bühnen erstreckt, mit einem erhöhten Rückzugsraum für Drogenexzesse und Orgien. Wobei solches Geschehen mit Live-Kamera auf eine Leinwand übertragen wird.
Offensichtlich ist das Thema Dekadenz und Verkommenheit, weil schon Sternheim eine Nebenfigur im „Blut und Boden“-Wahn daherfaseln lässt. Weil eine Kultur, die spätestens seit der Renaissance stets das Individuum glorifiziert hat, keine gesellschaftliche Ordnung hervorbringt, die die Auswüchse von Egoismus, Gier und Habsucht bändigen würde. Am Ende des Romans stirbt die allegorische Hauptfigur Europa folglich nach dem Ersten Weltkrieg bei revolutionären Umtrieben unter dem Beschuss von Soldaten des Ancien Régime.
„Es wird wärmer“
Castorf nimmt die weitere Entwicklung mit auf und führt bis in die Jetztzeit: So bildet ein grotesk verrenkter Schauspieler einmal das Hakenkreuz, einmal skandiert eine Gruppe: „AfD, AfD, AfD.“ Schließlich sind die Verhältnisse auch in der Gegenwart etwa durch das Erstarken des Nationalismus, durch die sich wieder öffnende Schere zwischen Arm und Reich, durch Globalisierung und kaum zu beherrschende Technologien in Fluss geraten.
War das Krokodil vielleicht ein Bote der Natur, die irgendwann eben doch mal den Rachen aufreißt? Eine Figur im Stück sagt nebenher: „Es wird wärmer.“ Weiter hinten brennt schon mal ein halber Erdteil weg.
Weitere Aufführungen im Schauspiel Köln, Schanzenstraße 6-20: 24. Januar, 7., 9. und 29. Februar. Beginn um 18 Uhr, sonntags um 17 Uhr. Karten: 0221-221 28400.